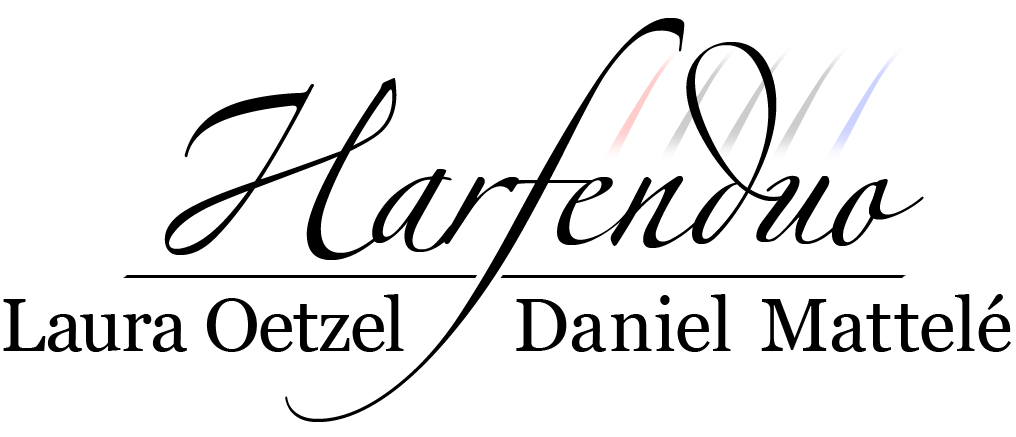Am 19. Juli berichtete Alexander Strauch im Bad Blog der nmz über den Kompositionswettbewerb „Beethoven – zurück in die Zukunft“ des Musikschulen-Verbands 2019. Die Ausschreibung des Wettbewerbs sei „ein Beispiel für Ausbeutung von einreichwilligen Komponistinnen und Komponisten“. Und sein Komponisten-Kollege Moritz Eggert kommentierte direkt auf Facebook: „unglaublich, was Alexander Strauch hier aufdeckt!“
Wir wollten natürlich wissen, was für ein riesengroßer Skandal hier ans Tageslicht kommt und lasen den Artikel. Kurz zusammengefasst war Folgendes passiert: Die Wettbewerbsausschreibung enthielt sehr ungünstige Konditionen für die Teilnehmer (u.a. ein Abtritt der Nutzungsrechte an den eingereichten Kompositionen) und versprach ein Preisgeld, das in keinem Verhältnis zum Aufwand stand. Als Referenz für ein angemessenes Preisgeld zitiert Alexander Strauch die Honorarrichtlinien für Auftragskompositionen. Diese Richtlinien enthalten unter anderem einen Stundenlohn von 24,60 € für die Vorbereitungszeit.
MusikerInnen werden also schlecht für ihre Arbeit bezahlt. Aha. Gibt’s sonst noch was Neues?
Schöne Zahlen
In der klassischen Musik kursieren in der letzten Zeit haufenweise Zahlen, was für welche Arbeit der richtige Lohn sei. Diese Zahlen haben allerdings mit der Realität nur noch wenig zu tun. Im Gegenteil, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit geht sogar immer weiter auseinander.
Zum Beispiel: 2004 vereinbarte der Deutsche Bühnenverband mit der Orchestergewerkschaft DOV feste (allerdings nicht verbindliche) Aushilfsgagen. Manche Orchester zahlten diese Gagen, manche nicht; offiziell blieben Aushilfsgagen „Verhandlungssache“. Seitdem gab es keine Erhöhung dieser Sätze. Dieses Jahr wollte nun die DOV die Sätze entsprechend der Tariferhöhung der Festangestellten (insgesamt 35%!) angleichen. Der Bühnenverband sperrte sich. Und auch die Orchester winkten ab. Wo solle denn dieses zusätzliche Geld herkommen? Die Sätze blieben also die gleichen und die DOV war gezwungen, im Juni 2019 die Aushilfen dazu aufzurufen, einfach höhere Gagen zu fordern. Weil das ja bisher so gut funktioniert hat.
Noch düsterer sieht es in anderen Verbänden aus. Die Thüringer Staatskanzlei listete 2018 einmal auf, was Aushilfen im Bundesland verdienen. Die Spanne reichte von 90 € bis 150 € pro Aufführung (Probenvergütung entsprechend geringer). In seiner Forderung, kleinere Orchester sollten die Mindesthonorare für freie Projekte zahlen, geht die DOV von einer Gage von 171,25 € pro Aufführung (plus Sonderzahlungen wie die Solo-Zulage) als absolutes Minimum aus. Selbst die Staatskapelle Weimar, immerhin ein A-Orchester, liegt ca. 30 % unter diesen Mindeststandards. Angesprochen auf dieses Missverhältnis reagieren Orchester nach unserer Erfahrung immer gleich: Es ist kein Geld da, um diese Aushilfssätze zu zahlen. Und sogar: Mit diesen Gagen wären Konzerte mit Aushilfen gar nicht mehr möglich, und die Aushilfen hätten gar keine Arbeit mehr.
In Brandenburg konnte das Landesparlament 2018 davon überzeugt werden, „Mindestlöhne“ für freie MusikerInnen gesetzlich einzuführen. Diese Regelung soll ab 2021 gelten. Kritiker befürchten jedoch, dass die eigentlich sinnvolle Neuerung nach hinten los gehen könnte: Die Regelung beträfe nämlich nicht die festangestellten MusikerInnen, die quasi nebenher als Aushilfe in anderen Orchestern spielen. Sie wären dann „billiger“ als die Freischaffenden, die keine Angebote mehr bekämen und somit die Leidtragenden wären.
Es ließen sich noch viele weitere Beispiele finden. Etwa aus dem Bereich Musikschulen, wo flächendeckend feste Stellen in billige Honorarverträge umgewandelt werden, ganz einfach deshalb, weil teilweise seit Jahrzehnten die Budgets der Musikschulen nicht erhöht oder sogar gekürzt wurden. Auch auf dem freien Markt kann man ja gerne mal versuchen, Stundenlöhne von 24,60 € für die Vorbereitungszeit (!) eines Konzerts zu fordern…
Lässt sich klassische Musik überhaupt noch finanzieren?
Die Zeiten, in denen eine klassische Musikveranstaltung zuverlässig Profit abwarf, sind lange vorbei. Die Kosten sind hoch, die MusikerInnen müssen lange und intensiv ausgebildet werden und die Nachfrage des Publikums sinkt stetig. Der klassische Musikbetrieb läuft nur noch deshalb so gut, weil er massiv subventioniert wird. Staatliche und private Geldgeber fördern gerne prestigeträchtige Projekte – alles andere fällt hinten runter. Besonders kleine „Anbieter“ leiden darunter, weil sie mit den großen Agenturen oder international tätigen Orchestern nicht mithalten können. Und das Publikum hat sich an Eintrittspreise gewöhnt, die irgendwo im Bereich zwischen „viel zu billig, weil gefördert“ und „viel zu teuer, trotzdem nicht kostendeckend“ liegen.
Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich: Wird die Förderung eines Projekts eingestellt oder zurückgefahren, ist das Projekt stark gefährdet. Um das zu vermeiden, wird dann gerne getrickst. Ein befreundeter Orchestermusiker berichtete uns, die Planstellen inklusive aller laut Tarifvertrag vorgesehenen Vergütungen seines A-Orchesters seien mit dem Budget, das ihnen zur Verfügung stehe, gar nicht zu bezahlen. Um den Status als A-Orchester nicht zu verlieren müsse man beispielsweise Stellen ausschreiben und dann im Probespiel niemanden nehmen. Oder man müsse Stellen mit PraktikantInnen besetzen. Denn der A-Orchester-Statusverlust würde zu einer Kürzung der Fördermittel führen und die ganze Sache ginge von vorne los.
- Zum besseren Verständnis stellen wir diese Geschichte einmal mit konkreten, wenn auch fiktiven Zahlen nach: Angenommen, ein A-Orchester braucht laut Tarifvertrag 10 Planstellen à 50.000 € Jahresgehalt. Dann benötigt es ein Jahresbudget von 500.000 €, das sich aus Einnahmen und Fördermitteln zusammensetzt, beispielsweise 100.000 € Einnahmen und 400.000 € Fördermitteln. Jetzt werden die Fördermittel auf 300.000 € gekürzt. Von diesem Budget lassen sich aber nur noch 8 Planstellen finanzieren. Würde das Orchester nun 8 MusikerInnen fest anstellen und die letzten beiden wegkürzen, ginge der Status als A-Orchester verloren und das Orchester würde nur noch als B-Orchester mit 8 Planstellen à 40.000 € Jahresgehalt eingestuft. Aufgrund des Status-Verlusts und der Verschlankung des Spielplans sinken die Einnahmen auf beispielsweise 60.000 € und das Orchester wird für die Geldgeber weniger interessant; sie fördern das Orchester nur noch mit 240.000 €. Das Budget sinkt also weiter und es stünden nur noch 37.500 € Jahresgehalt pro Person zur Verfügung. Es ließen sich also auch die 8 Planstellen nicht mehr finanzieren. Das Orchester gerät in eine kaum aufzuhaltende Abwärtsspirale. Um dem entgegenzuwirken stellt das Orchester nur noch 6 MusikerInnen fest an. Das übrige Budget wird auf vier PraktikantInnen verteilt, die „übergangsweise“ die vakanten Positionen besetzen. Trotz geringerem Budget behält das Orchester so seinen A-Status, allerdings auf Kosten der PraktikantInnen, die eigentlich eine reguläre Stelle bei geringerer Bezahlung besetzen, sowie des Arbeitsmarktes, auf dem 4 feste Stellen weniger angeboten werden können.
Der Konzertbesucher erfährt von alledem natürlich nichts. Die Qualität von freien MusikerInnen oder selbst PraktikantInnen ist oft so hoch, dass die Gesamtqualität des Orchesters manchmal sogar noch aufgewertet wird. Den wenigsten dürfte wohl bewusst sein, dass der (oft immer noch stolze) Eintrittspreis bei denjenigen, denen man auf der Bühne applaudiert, gar nicht ankommt.
Brauchen wir mehr Arbeitskampf der Geringverdiener?
Trotz der oben geschilderten Lage der klassischen Musik geht der Trend der letzten Zeit wie gesagt dahin, höhere Gagen zu fordern. Der Effekt auf die Gagen geht dabei, wie das Beispiel der Aushilfen zeigt, gegen null. Von diesen Forderungen allein werden die entsprechenden Fördergelder selten erhöht, daher gibt es für Orchester, Musikschulen oder Konzertveranstalter schlicht keine Möglichkeit, höhere Gagen zu zahlen. Die Eintrittspreise oder Musikschulgebühren zu erhöhen, ist auch keine Option. Das Publikum hat sich eben daran gewöhnt, dass eine Stunde Kammermusik auch schon mal für 5 € zu hören ist.
- Was würde eine Eintrittskarte für unsere Duo-Konzerte kosten, wenn wir einen Stundenlohn von 24,60 für die Vorbereitungszeit berechnen würden? Hier eine Beispielrechnung: Wir haben früher einmal exemplarisch beobachtet, dass wir für 15 Minuten Musik ca. 100 Stunden Übe- und Probezeit pro Person brauchen. Ein einstündiges Programm benötigt also 800 Stunden Arbeitszeit. Das ergibt einen Gesamtlohn von fast 20.000 €. Hinzu kommen noch Kosten für Saalmiete, GEMA, Versicherungen, Druckkosten sowie eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden, die für die Planung der einzelnen Konzerte draufgeht. Eine Tournee von uns umfasst etwa 15 Konzerte. Vorsichtig geschätzt betragen die Kosten pro Konzert noch einmal 500 €, insgesamt also 7.500 €. Wenn wir annehmen, dass zu jedem Konzert 40 Zuhörer kommen, verkaufen wir insgesamt 600 Karten pro Jahr. Rechnet man das alles zusammen, kommt man auf einen Kartenpreis von etwa 45 €. Und das ist noch konservativ geschätzt; wir wirtschaften dadurch, dass wir pro Jahr nur ein Programm vorbereiten, noch verhältnismäßig günstig. Und man darf ja auch nicht die enorm hohen laufenden Kosten vergessen, die man als MusikerIn hat, beispielsweise für Auto, Instrument, Wartung, Ersatzsaiten, Noten, etc…
Das alles ist allerdings nur ein Teil der Geschichte. Denn jeder, der sich in der Klassik-Szene bewegt, wird schon festgestellt haben, dass beim richtigen Anlass auf einmal doch Geld für verschiedenste Posten vorhanden ist. Da sind dann 10-minütige Auftritte von Star-Dirigenten oder Operndiven und die Anschaffung von vergoldeten Drumsets plötzlich sehr wohl möglich. Eine befreundete Harfenistin berichtete uns einmal, dass der Verkauf der alten Orchesterharfe ins Leere lief, obwohl schon ein Käufer gefunden war, der die hohe vierstellige Summe bezahlen wollte. So nötig hatte das Orchester dieses Geld wohl nicht. Die Aushilfssätze sind in diesem Orchester übrigens besonders niedrig. Begründung: Kein Geld…
Ohne eine „Neiddebatte“ lostreten zu wollen: Bei einer anderen Verteilung der Mittel wäre eine faire (oder zumindest fairere) Bezahlung sehr wohl möglich! Und wie sollen die Geldgeber denn wissen, was sie eigentlich bezahlen müssten, wenn ein Projekt durch schlechte Bezahlung der MusikerInnen schöngerechnet wird? Wenn jemand mit einem eigentlich zu niedrigen Budget auskommt, wird der Geldgeber dieses im nächsten Jahr wohl kaum erhöhen. Arbeitskampf lohnt sich also auf jeden Fall!
Aber…
Selbst wenn wir faire Gagen für alle MusikerInnen hätten, würde das nichts daran ändern, dass der klassische Musikbetrieb in seiner jetzigen Form vielleicht gar nicht mehr funktionieren kann. Mit dieser Meinung stehen wir übrigens nicht alleine da. Zum Beispiel: In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 23.05.2019 spricht der Geiger Frank Peter Zimmermann über Musikaufnahmen und Plattenverträge. Er ist der Meinung, dass man heute als klassische(r) MusikerIn mit einer Aufnahme überhaupt kein Geld mehr verdienen kann. Besonders junge KünstlerInnen würden in unvorteilhafte Verträge gedrängt. Die KünstlerInnen willigen natürlich ein, weil sie die große Karriere wittern. Dann würden sie „über fünf bis zehn Jahre ausgelutscht, notfalls mit dreihundert Konzerten im Jahr“. Danach verschwinden sie wieder von der Bildfläche.
Und da wären wir wieder beim Ausgangspunkt und dem Kompositionswettbewerb. Es hat sich als bekanntes Muster etabliert, dass besonders junge MusikerInnen zu niedrigen Löhnen arbeiten und an ausbeuterischen Wettbewerben teilnehmen müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, sich „nach oben“ zu arbeiten und ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Jeder weiß, dass dieses System nicht funktioniert: Der Kuchen ist einfach nicht groß genug! Aber welche Wahl hat man denn als junge(r) MusikerIn?
Und nun kommen die „schönen Zahlen“ ins Spiel. Man muss sich einmal die Frage stellen: Wem nutzen Forderungen, die sich auf dem freien Markt nicht umsetzen lassen? Natürlich denen, die es sich leisten können, solche Gagen zu fordern. Denn in diesem ganz kleinen Ausschnitt der Musikbranche – manche nennen ihn auch „Elfenbeinturm“ – hat Musik noch den Wert, den sie verdient. Diesen Status gilt es für jene, die sich in diesen Kreisen bewegen, aufrecht zu erhalten.
Wollte man dieses Problem grundsätzlich lösen und dafür sorgen, dass alle MusikerInnen faire Löhne bekommen, müsste man viel grundlegender ansetzen. Warum zum Beispiel sind die Aushilfssätze in Orchestern nicht Teil des Tarifvertrags? Warum bilden wir wesentlich mehr MusikerInnen an den Musikhochschulen aus, als der Markt braucht? Warum halten wir nach wie vor an der Illusion fest, dass ich, wenn ich nur genug übe, später auf jeden Fall eine gut bezahlte Stelle bekomme? Warum gilt ein(e) MusikschullehrerIn nach wie vor in vielen Kreisen als „gescheiterte(r) MusikerIn“?
Diese Fragen sind unbequem, klar. Aber der Grund, warum wir uns in der klassischen Musik so schwer mit ihnen tun, ist, dass sie vor allem von denen gestellt werden, die es nicht „nach oben“ geschafft haben. Und diese MusikerInnen sind selten in Positionen, wo sie Entscheidungen über solche Fragen treffen könnten. Diese Fragen könnten also nur angegangen werden, wenn MusikerInnen in Führungspositionen gegen ihre eigenen Interessen entscheiden würden.
Das kann man tun
Die Probleme der klassischen Musik sind sehr grundsätzlich. Wenn wir so weiter machen wie bisher, werden immer mehr HochschulabsolventInnen Schwierigkeiten haben, sich auf einem überfüllten Arbeitsmarkt durchzusetzen. Es muss also etwas getan werden. Nur, was?
Wie schon geschrieben, sind kleine Maßnahmen wichtig. Jeder, vor allem aber die „arrivierten“ MusikerInnen, sollten schauen, was sie in ihrem Umfeld bewirken können. Beispielsweise können die festangestellten OrchestermusikerInnen gegenüber dem Management auf fairen Gagen für die Aushilfen bestehen und es ablehnen, aus Gefälligkeit bei Laien-Orchestern umsonst zu spielen, weil sie persönlich das Geld nicht brauchen. Festangestellte MusikschullehrerInnen können sich bei ihrer Verrentung dafür einsetzen, dass ihre Stelle für den Nachfolger nicht in eine Honorarstelle umgewandelt wird. Dirigenten und Festivalleiter sollten nur solche Projekte verwirklichen, bei denen alle Aushilfen fair bezahlt werden können, und nicht aus persönlichem Ehrgeiz mit ihren Streichorchestern die Alpensinfonie aufführen.
Aber bei solchen Maßnahmen muss man immer aufpassen, dass sie letztendlich nicht die Gesamtsituation verschlechtern bzw. die Probleme nicht nur in einen anderen Bereich verschieben. Sie werden auf Dauer auch nicht ausreichen. Es braucht deswegen neue Debatten darüber, wie der Markt für klassische Musik in der Zukunft aussehen soll. Dafür braucht es auch politische Lösungen.
Zunächst sind hier natürlich die Geldgeber gefragt. Wer sich mit einem städtischen Spitzenorchester schmücken will, der muss auch soviel Geld zur Verfügung stellen, dass alle Beteiligten anständig bezahlt werden können. Wer einen Wettbewerb ausschreibt, muss faire Teilnahmebedingungen schaffen und nicht nur darauf achten, dass die Sponsoren gut dastehen. Wer die Schülerzahlen einer Musikschule verdoppeln will, darf nicht mit einem nahezu unveränderten Budget planen. Und wenn das Geld dafür nicht da ist, dann muss man eben auch einmal in den sauren Apfel beißen und sagen: Dieses Projekt ist so nicht realisierbar! Nur so entsteht für die MusikerInnen, besonders für BerufsanfängerInnen, ein realistisches Bild des Arbeitsmarkts.
Aber auch wir MusikerInnen müssen umdenken. Hier sind in erster Linie die Musikhochschulen gefragt, da sie maßgeblich für die Überfüllung des Arbeitsmarktes verantwortlich sind. In ihrer Studie „Musikstudium und danach“ stellt die Oboistin Esther Bishop fest, dass es 2012 43 % mehr AbsolventInnen in Deutschland gab als noch 2000. Gleichzeitig ist die Zahl der Orchester aber von 168 (1992) auf 131 (2014) zurückgegangen. Im Ergebnis stieg die Zahl der freischaffenden MusikerInnen von 14.649 (1992) auf 51.527 (2015) an. Die Musikhochschulen müssen also endlich damit aufhören, aus Prestigegründen neue Instrumental-Klassen zu gründen oder bekannte MusikerInnen an ihre Häuser zu holen, ohne dass dafür ein Bedarf besteht. Natürlich muss es auch die Spitzen-SolistInnen geben, damit all die geniale und wunderschöne Musik auch weiterhin zu hören ist. Aber was ist mit all den anderen Berufsbildern, die bei dem veränderten Arbeitsmarkt immer wichtiger werden? Diese werden im Studium nach wie vor größtenteils vernachlässigt.
Vielleicht muss man sich allmählich auch über unkonventionelle Lösungen Gedanken machen. Man stelle sich einmal vor, MusikerInnen würden den AutraggeberInnen einfach Rechnungen über die geleisteten Arbeitsstunden stellen, wie ein Handwerker. Oder es gäbe einen gesetzlich vereinbarten Mindestlohn für MusikschullehrerInnen – einklagbar bei Nichtzahlung. Oder wie wäre es mit einem Grundeinkommen für KünstlerInnen? Klar, jeder dieser Vorschläge hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn wir in der klassischen Musik den Kollaps verhindern wollen, wie er beispielsweise im Pflegebereich schon längst passiert ist, müssen wir auch für radikale Maßnahmen offen sein.