Eines vorweg: Die Corona-Krise ist bei weitem noch nicht ausgestanden! Die Überlegungen, die wir in diesem Beitrag anstellen, beziehen sich daher ausschließlich auf die jetzige Situation. Es ist gut möglich, dass wir schon in wenigen Wochen oder Monaten mit ganz anderen Realitäten konfrontiert werden, die wiederum ganz andere Konsequenzen zur Folge haben werden. Doch blicken wir einmal hoffnungsvoll in die Zukunft und gehen davon aus, dass wir die Corona-Krise in absehbarer Zeit überwinden werden. Dann stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es dann weiter? Wie wird unsere Gesellschaft aussehen? Und vor allem: Wie wird das Verhalten einzelner im Nachhinein bewertet werden? Das sind natürlich komplexe und eher spekulative Fragen, doch möchten wir im Rahmen unserer eigenen beruflichen Tätigkeit, also im Bereich klassische Musik, ein paar Dinge analysieren und Prognosen wagen.
Was in der klassischen Musik bisher schon falsch lief
Bisher funktionierte die klassische Musik vor allem nach einem Grundprinzip: Wer der oder die beste MusikerIn ist, schafft es nach oben. Und dahin gelangt man, indem man viel übt. Dieses einfach klingende Mantra schallt seit Jahrzehnten durch die Flure der Musikhochschulen, Konzertagenturen und Opernhäuser. In Frage gestellt wird das selten. Das liegt vor allem an zwei Gründen: Erstens ist der Traum von der großen Karriere ein wichtiger Antrieb für jede(n) angehende(n) MusikerIn. Wer würde bitteschön Musik studieren wollen, wenn die Botschaft lauten würde: „Wer es nach oben schafft, wird per Los bestimmt“? (Ganz so krass ist es natürlich nicht, schon klar.) Zweitens haben die MusikerInnen, die es nach oben geschafft haben, in der Regel kein Interesse daran, das System, was sie dorthin gebracht hat, in Frage zu stellen. Und meistens sind es diese MusikerInnen, die die Geschicke der Musikszene bestimmen.
Doch auch, wenn dieses Grundprinzip einer gewissen Logik nicht entbehrt, hat es eine sehr unangenehme Implikation, die oft vergessen wird: Wer es nicht nach oben geschafft hat, hat eben nicht genug geübt! Davon wird zumindest stillschweigend ausgegangen, wenn es um die berufliche und finanzielle Situation von Honorarkräften, Lehrbeauftragten oder Orchesteraushilfen geht. Die Karriere einer Musikerin, die nicht Professorin, Orchestermusikerin in einem Spitzenorchester oder gefeierte Solistin geworden ist, wird schnell als „gescheitert“ bezeichnet.
Da nun auch selbst der von sich am meisten überzeugte Musikprofessor nicht ernsthaft behaupten kann, der Großteil der MusikerInnen seien „gescheitert“, wurde lange so getan, als seien freiberufliche MusikerInnen die große Ausnahme von der Regel der Festanstellung. Und selbst wer diesen Berufsweg „freiwillig“ wählt, lebt eben ein Bohème-Künstler-Luxus-Leben. Inklusive Rotweinexzessen, ausschweifendem Sexleben und vier- bis fünfstelligen Gagen. Die Realität für freie MusikerInnen sieht natürlich anders aus:
- Viele Musikschulen beschäftigen überwiegend nur noch Honorarkräfte
- Lehrbeauftragte an Musikhochschulen verrichten dieselbe Arbeit wie ProfessorInnen – für einen Bruchteil deren Gehalts
- Orchester erhöhen über teilweise Jahrzehnte die ohnehin schon lächerlich niedrigen Aushilfsgagen nicht
- Die Anzahl der freien MusikerInnen hat sich seit 1992 vervierfacht, weil die Musikhochschulen immer mehr MusikerInnen ausbilden, die festen Stellen aber weniger werden
- Das Durchschnittsjahreseinkommen freischaffender MusikerInnen beträgt laut KSK lediglich ca. 14.500 €
Diese Fakten passen natürlich nicht ins Bild vom freien Künstlerleben und wurden daher in der Musikszene größtenteils ignoriert. Gleichzeitig führte das überhöhte Karriereziel auch dazu, dass viele MusikerInnen sich nicht gegen schlechte Bezahlung oder mangelnden Respekt gegenüber ihrer Arbeit wehrten. Die innere Haltung des Versagens ist bei vielen MusikerInnen so fest verankert, dass aus Scham kein Aufbegehren erfolgt. Dazu kommt noch ein weiteres Problem: Nicht wenige MusikerInnen sind durch Erlebnisse im Musikstudium traumatisiert und damit psychisch nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft aus prekären Arbeitsverhältnissen zu befreien.
Corona bringt den Kollaps
In der letzten Zeit mehrten sich allerdings die Stimmen, die dieses Konstrukt immer mehr kritisierten. Doch die Situation war schon extrem festgefahren, da dieser Aufschrei mindestens zehn, eher zwanzig Jahre zu spät kam. In der Zwischenzeit hatten sich nämlich Musik(hoch)schulen, Orchester, Sponsoren und natürlich die Kommunen, Länder und der Bund in viel zu niedrigen (Kultur-)Etats bequem eingerichtet. Aus der Politik hörte man immer wieder: „Der Markt wird es schon richten.“ Dass diese Hypothese nichts mehr mit der Realität zu tun hatte, durften unter anderem die Orchesteraushilfen 2019 erfahren, als ihr Kampf für höhere Gagen letztendlich daran scheiterte, dass die Orchester selbst bei gutem Willen schlichtweg nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügten. Also wurden mal wieder Abmachungen auf freiwilliger Basis vereinbart; der oder die KünstlerIn als letzte(r) in der Hackordnung hatte immer noch keine Macht über die eigene Bezahlung bekommen. Alles lief weiter wie bisher und die Orchester rechneten wohl damit, dass durch die erzielte „Einigung“ in den nächsten Jahren Ruhe herrschen würde. Was sollte schon passieren? Die freiberuflichen MusikerInnen waren bisher doch auch ganz gut klargekommen. „Et hätt noch emmer joot jejange“, es ist bisher noch immer gut gegangen, wie man im Rheinland sagt. Doch dann kam Corona und mit einem Mal zeigte sich die ganze Dramatik der Situation.
Durch die Absage von Veranstaltungen und Schließung von Musikschulen standen die meisten freischaffenden MusikerInnen von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts. In der Regel brachen ihnen 100 % des Einkommens weg, während Miete, Versicherungen und Nahrungsmittel natürlich weiter bezahlt werden wollten. Zunächst sah es so aus, als sollten die Freiberufler mal wieder übersehen werden; Wirtschaftsminister Altmeier (CDU) sprach in einem ersten Statement davon, man wolle „den Unternehmen“ finanziell helfen. Doch schon bald zeigte sich, dass bei den Freiberuflern – nicht nur im Musiksektor – ein riesiges Problem auf uns zukam. Denn obwohl die Freischaffenden nach wie vor den Status eines gesellschaftlichen Randphänomens haben, kann ohne sie keine Oper mehr aufgeführt werden und keine Musikschule ihren Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten. Trotzdem haben sie in vielen Fällen keinerlei finanzielle oder soziale Absicherung.
Auf ihrer Internetseite hat die Gewerkschaft ver.di ein Hilfeportal für Selbstständige eingerichtet. Dort wird der Umgang mit den Selbstständigen stark kritisiert: „Es hapert vor allem an konkreten Hilfen für Solo-Selbstständige, wenn Aufträge abrupt wegbrechen. – Da wurde in der Vergangenheit schlicht versäumt, rechtliche und sozialstaatliche Regeln zu etablieren, die auch die konkreten Lebens- und Erwerbslagen der Solo-Selbstständigen berücksichtigen. […] Wir werden mittelfristig noch einmal darüber reden müssen, ob Menschen oder »die Wirtschaft« Hauptziel der staatlichen Fürsorge sein sollen – und damit über die Themen Umverteilung und Gerechtigkeit, wenn in der näheren Zukunft die Gesellschaft über die Verteilung der Kosten zur Bewältigung der Krise verhandelt.“
Es sollte nun auch dem letzten klar werden, dass die aktuelle Krise ein Problem deutlich macht, dass viel zu lange ignoriert wurde: Der Umgang mit Freischaffenden KünstlerInnen ist schäbig und führt zu großer Armut und Ungerechtigkeit. Es wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, die es jetzt zu korrigieren gilt. Ein „weiter wie bisher“ kann es jetzt nicht mehr geben. Es kann nicht sein, dass der Arbeitsmarkt in der klassischen Musik so gestaltet ist, dass einige wenige komfortabel von ihrer Kunst leben können, während die, die die Basis für eine ganze Branche bilden, fast flächendeckend prekär beschäftigt sind und das komplette Risiko tragen!
Das große Sozialexperiment des „freien Marktes“ ist gescheitert. Dieser Meinung ist Christoph Butterwegge, deutscher Politikwissenschaftler und Armutsforscher. In einem Gastbeitrag für den Kölner Stadtanzeiger vom 26. März 2020 schreibt er: „Marktradikalismus war gestern. In Zukunft gilt: Retten kann uns nicht der von den meisten Ökonomen, aber auch Politikern und Publizisten vergötterte Markt, sondern nur ein funktionsfähiges, gut ausgestattetes Gesundheits- und Sozialsystem. Wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass die Sozial- und Gesundheitspolitik der vergangenen Jahrzehnte unserem Gemeinwesen geschadet hat und Solidarität statt Wettbewerbswahn und Ellenbogenmentalität herrschen muss, hätte das Virus für die Gesellschaft am Ende auch etwas Gutes bewirkt.“
Hilfe für freischaffende MusikerInnen
Immerhin wurde auf die Notlage der Freiberufler reagiert: Mehrere Länder beschlossen Sofortmaßnahmen und Hilfspakete, die Deutsche Orchester-Stiftung richtete ein Spendenkonto ein und auch der Bund verabschiedet Gesetze im Eilverfahren, damit Selbstständige schnell an Gelder kommen. Auf der Seite der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) gibt es einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen. Wenn man sich diese ansieht, fällt sofort auf: Die Soforthilfe-Beträge sind einerseits oft viel zu gering (beispielsweise 500 € bei der DOS), andererseits ist die Beantragung mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Ein Extremfall scheint die „unbürokratische“ Beantragung von Grundsicherung in Hamburg zu sein, für die man allen Ernstes 20 Dokumente ausfüllen muss (laut Süddeutscher Zeitung). Es ist zu erwarten, dass viele KünstlerInnen, aber auch andere Selbstständige nicht in der Lage sein werden, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Hinzu kommt – Föderalismus sei Dank –, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Wer beispielsweise in einem Bundesland wohnt, aber sein Geld hauptsächlich in einem anderen verdient, kommt schnell in Zuständigkeits-Konflikte.
Die Hilfen von Bund und Ländern werden nicht reichen, um die freischaffenden MusikerInnen durch die Krise zu bringen. Hier ist die Solidarität aller gefragt. Wir hatten schon darüber berichtet, dass beispielsweise die Musikschule Sankt Augustin ihren Honorarkräften zunächst weiter ihre Honorare zahlt. Andere Musikschulen sind diesem Beispiel gefolgt. Doch es gab offenbar auch Musikschulen, die einen anderen Weg einschlugen: Auf Facebook kursierte ein Schreiben eines Musikschulleiters, der seinen Honorarkräften kein Honorar mehr zahlen wollte, sie gleichzeitig aber dazu aufforderte, weiter Aufgaben in der Musikschule wahrzunehmen und sich um die SchülerInnen zu kümmern. [Anmerkung: Mittlerweile haben wir erfahren, dass dieser Musikschulleiter seine Entscheidung revidiert hat und die Honorarkräfte jetzt weiter bezahlt werden.] Eine andere Musikschule forderte nach unseren Informationen ihre (immerhin festangestellten) Lehrer dazu auf, trotz abgesagten Unterrichts ihre Arbeitszeit in der Musikschule zu verbringen. Zuwiderhandlungen würden mit Abmahnungen und Kündigungen sanktioniert.
Eine andere, private Musikschule stellte es ihren LehrerInnen frei, ob sie weiterhin unterrichten wollten – trotz Kontaktverbot. Und hier zeigt sich das Dilemma der prekär Beschäftigten: Wer über keinerlei Rücklagen verfügt ist natürlich viel stärker versucht, gegen das Kontaktverbot zu verstoßen, um wenigstens noch ein bisschen Geld zu verdienen. Noch kurz bevor das verschärfte Kontaktverbot in Kraft trat, begegneten uns auf Facebook Konzertankündigungen „trotz Corona“. Die Gäste könnten sich ja im Abstand von zwei Metern in die Zuschauerbänke setzen. Dass die Zuschauer ja auch irgendwie zum Saal und dann zu ihrem Platz hinkommen mussten und auf dem Weg dorthin Kontakt zu dutzenden Menschen haben würden, war den VeranstalterInnen entweder nicht klar oder sie nahmen dieses Risiko aus Existenzängsten in Kauf.
Solidarität – leider nicht überall
Schöne Beispiele für solidarisches Handeln gibt es auch aus der Orchesterlandschaft: Das SWR-Sinfonieorchester spendete 20.000 € für den DOS-Nothilfefond und manche Orchester wie beispielsweise das Theater Hof oder das Gürzenich-Orchester Köln haben angekündigt, ihren Aushilfen für die ausgefallenen Konzerte die Gagen in voller Höhe zu zahlen. Doch nicht alle Orchester zeigen sich so solidarisch. Es gibt auch diejenigen, die noch nicht einmal Ausfallgagen zahlen wollen und die freischaffenden MusikerInnen so komplett alleine lassen. Man habe eine Verpflichtung gegenüber den festangestellten MusikerInnen, heißt es dann. Auf den ersten Blick verständlich, doch kann man sich schon fragen, warum die freischaffenden MusikerInnen, die selbst vor der Privatinsolvenz stehen, „freiwillig“ auf Ausfallgagen verzichten sollen, um die entsprechenden Orchester vor der Pleite zu bewahren. Man darf gespannt sein, wie die Orchester gedenken, diese großzügige Geste in Zukunft zu vergelten. Es würde uns nicht wundern, wenn es nach der Krise heißt, nun müsse man die Aushilfssätze senken, um die Einnahmeeinbußen zu kompensieren.
Besonders dreist erscheint uns in diesem Zusammenhang auch die Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV). Seit Jahren vermittelt sie Aushilfsjobs in Orchestern an freie MusikerInnen. Diese Jobs sind oftmals gruselig schlecht bezahlt und landen nur deshalb bei der ZAV, weil die Orchester selbst niemanden mehr finden, der bereit ist, für solche Gagen zu spielen. Beispielsweise haben uns in den letzten Jahren zahlreiche Anfragen des Theaters Görlitz erreicht. Gagenangebot für eine Probe: 55 €. Fahrtkostenzuschuss von Weimar nach Görlitz (ca. 300 km): 0 €. Wir haben uns immer gefragt, warum die ZAV solche Jobs vermittelt. War es ihnen nicht bewusst oder sogar egal, dass sie die MusikerInnen so auf direktem Wege ins Prekariat schicken? Nun hat die ZAV eine Rundmail geschrieben: MusikerInnen, die jetzt ohne Einkommen dastünden, sollten doch bitte Hartz IV beantragen…
Konsequenzen aus der Krise
Es gibt positive und negative Beispiele, wie Solidarität in der Krise funktionieren kann. Doch uns fällt vor allem auf: Es ist vollkommen zufällig, wer Geld bekommt und wer vor der Privatinsolvenz steht. Faktoren wie Wohnsitz, Ort der freien Tätigkeit, Alter und Geschlecht spielen eine größere Rolle, als wie fleißig man geübt hat. Danach fragt im Moment nun wirklich niemand mehr. In einem Sozialstaat darf es aber nicht vom Zufall abhängen, wer gut leben kann und wer auf der Straße landet. Es wird vielleicht unsere wichtigste Lehre aus der Krise sein, dass wir in den letzten Jahren den Sozialstaat immer weiter zu Gunsten des Märchens des freien Marktes abgebaut haben. Das fällt uns jetzt auf die Füße und muss dringend korrigiert werden.
Die Musikszene hat daran einen nicht unerheblichen Anteil. Seit Jahren wird gefordert, dass der politische Trick „Honorarkraft“ abgeschafft wird; stattdessen kommen immer neue Musikschulen dazu, die dieses Modell neu einführen. Die Lehrbeauftragten kämpfen gegen schlechte Bezahlung und für Gleichstellung mit ihren unbefristet angestellten Kollegen; stattdessen werden ihre Löhne über Jahrzehnte nicht erhöht. Die Orchesteraushilfen fordern verbindliche Sätze und eine Aufnahme ihrer Anliegen in den Tarifvertrag; stattdessen verweigern die Orchester und deren Geldgeber konsequent die Anerkennung ihrer Arbeit und beschließen „freiwillige“ Maßnahmen, an die sie sich selbstverständlich nicht zu halten gedenken. Diese Arbeitsmarktpolitik untergräbt den Sozialstaat und muss aufhören!
Ein Mittel dagegen sind feste Arbeitsverträge: Nur dann können Arbeitnehmer sich effektiv von Gewerkschaften vertreten lassen. Diese Arbeitsverhältnisse wurden im Musiksektor nicht etwa deshalb zurückgefahren, um den Freiberuflern mehr Freiheiten zu gewähren, sondern um den Arbeitnehmerschutz gezielt auszuhebeln. Und für Selbstständige muss wieder gelten: Wer die gleiche Arbeit wie ein(e) Festangestellte(r) verrichtet, muss mindestens genauso bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass Selbstständige ein viel höheres berufliches Risiko tragen und dennoch weniger verdienen als ihre festangestellten KollegInnen! Dieser Missstand ist ein starker Indikator für eine kaputte Branche, von der am Ende niemand profitiert; auch nicht die Festangestellten.
Klassische Musik nach Corona
Eines darf man bei der Corona-Krise auch nicht vergessen: Die Existenzbedrohung, die im Moment besonders viele Selbstständige trifft, gab es schon immer! Jede Honorarkraft muss damit rechnen, dass sie ohne Angaben von Gründen in wenigen Wochen gekündigt wird. Jede Orchesteraushilfe muss damit rechnen, dass sie von diesem oder jenem Orchester nie wieder etwas hört, weil einem Kollegen ihre Nase nicht gepasst hat. Jede(r) Lehrbeauftragte muss damit rechnen, dass sein oder ihr Vertrag nicht verlängert wird, weil die neue Hochschulleitung den Schwerpunkt von Jazz auf Alte Musik verlagern will. Auch in solchen Fällen steht man vor plötzlichen Einkommenseinbußen von 100 %. Der Unterschied zu jetzt ist lediglich, dass es vorher nicht so aufgefallen ist. Corona entlarvt also bloß die Schwachstellen der Branche.
Im Moment bekommen die Orchester und Musik(hoch)schulen Applaus, der sich durch besonders solidarische Aktionen hervor tun. Das ist natürlich auch gut und richtig, da sie so als gutes Beispiel für andere gelten können. Aber man wird nach der Krise auch genau schauen müssen, wer sich nicht solidarisch gezeigt hat. Momentan erscheint es vielleicht wirtschaftlich notwendig oder sogar unternehmerisch clever, seine Aushilfen und Honorarkräfte im Stich zu lassen. Doch nach der Krise könnte sich das ändern: Es wäre nicht das schlechteste Zeichen für ein sozialeres Miteinander, wenn solche Institutionen Probleme bekommen würden, Sponsorengelder zu akquirieren und Publikum anzuziehen. Es ist daher wichtig, auch die negativen Beispiele anzusprechen. Nicht, um die Verantwortlichen an den Pranger zu stellen, sondern um sie – auch im eigenen Interesse – zur Vernunft zu bringen.
Oder wir lassen einfach alles in der Musikbranche, wie es ist. Hat ja bisher auch wunderbar funktioniert. Dann wäre die logische Konsequenz doch eigentlich folgende: Man könnte doch ein deutschlandweites Probespiel veranstalten und den Gewinnern dann Soforthilfen auszahlen. All die anderen würden natürlich die Hunde beißen, aber was soll’s?
Klingt absurd? Nun, nach diesem Prinzip hat die klassische Musik bisher funktioniert. Vielleicht wird es Zeit, dieses Prinzip über Bord zu werfen. Dann „hätte das Virus für die Gesellschaft am Ende auch etwas Gutes bewirkt.“
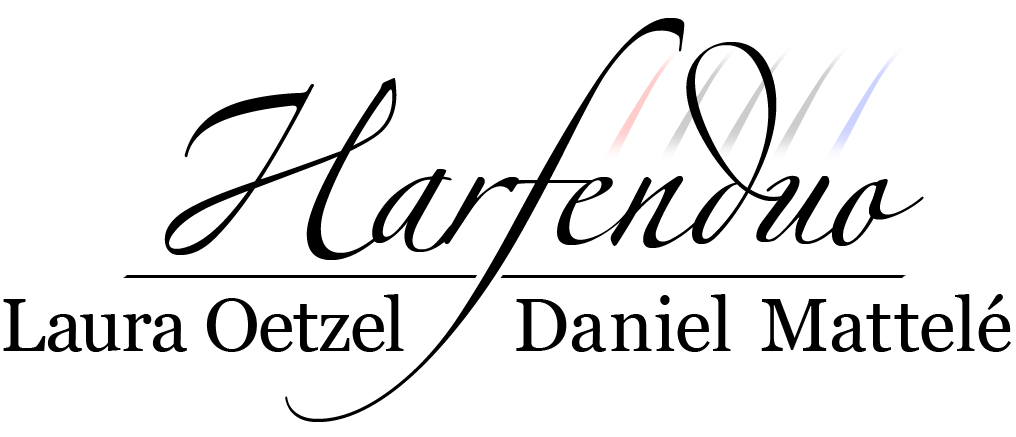



3 Comments
Das gleiche gilt auch für Freiberufler im Bereich Museum/Kunstvermittlung. In “meinem” Museum habe ich sehr nette KollegInnen und ein gutes Arbeitsklima, meine Arbeit wird geschätz und wennn alles läuft ist es gut. Aber wehe, wenn es nicht gut läuft und beispielsweise doch nicht so viele BesucherInnen in die Ausstellung kommen wie geplant: dann kann es passieren, dass im laufenden Bertrieb das Vermittlungsangebot gekürzt wird. Die Vorbereitung für wechselnde Ausstellungen sind oft sehr aufwändig (wird übrigens auch nicht bezahlt), man hat aber keinerlei Planungssicherheit, wie oft man dann eingesetzt wird. Neulich saß ich wegen einer Streckensperrung in der Bahn fest und habe so eine Führung verpasst, eine Kollegin ist freundlicherweise für mich eingesprungen, sonst hätte ich, zusätzlich zu meinem Verdienstausfall, auch noch die Stornokosten bzw. “Kompensationskosten” für die ausgefallene Führung an der Backe gehabt. In meinen Verträgen gibt es auch den Abschnitt “Ausfallhonorar”, der natürlich im Zuge der Corona-Krise nicht greift, mir sind bis jetzt Aufträge im vierstelligen Euro-Bereich weggebrochen. Wie schon in einem früheren Kommentar geschrieben: alle Pflichten, keine Rechte.
Ich liebe meine Arbeit und freue mich jetzt schon auf die Zeit, wenn der Kulturbertrieb wieder in Schwung kommt (wann auch immer das sein mag) – und dann kommt mir der subversive Gedanke: was, wenn wir Freiberufler ALLE solidarisch wären und einfach nicht mehr zu solchen Bedingungen arbeiten würden (schlimmer als im Moment kann’s ja nicht werden…). Stell dir vor es ist Kultur und keiner von uns geht hin!
“was, wenn wir Freiberufler ALLE solidarisch wären und einfach nicht mehr zu solchen Bedingungen arbeiten würden (schlimmer als im Moment kann’s ja nicht werden…). Stell dir vor es ist Kultur und keiner von uns geht hin!”
Ein ganz toller Gedanke. In diese Richtung versuche ich jetzt zu gehen. Suche mir Arbeit in Festanstellung, völlig egal, als was. Sogar eine Halbtagsstelle wäre willkommen. Wenn ich dann noch Zeit und Lust habe, kann ich immer noch 2-3 Schüler privat unterrichten. Tja, nach 21 Jahren Honorarkraft- Dasein bin ich, glaube ich, entgültig therapiert. Ich hoffe sehr, dass unser Beruf “Musikpädagoge” bald ausstirbt.
Das ist natürlich der „worst case“, wenn die MusikpädagogInnen ihren Beruf an den Nagel hängen wollen. Aber absolut verständlich – die Situation war eigentlich jahrzehntelang unerträglich, jetzt in der Krise zeigt es sich nur besonders dramatisch. Wenn man unseren Berufsstand – und den anderer Kulturschaffender – erhalten will, muss man die prekären Arbeitsverträge abschaffen! Hoffentlich wird es nach Corona noch ein Umdenken in der Gesellschaft geben.
Viele Grüße
Laura & Daniel