Wer im Musikstudium einen Bachelor-Abschluss (früher auch Diplom) erwirbt, kann sich für einen Masterstudiengang bewerben. Theoretisch gibt es hierbei verschiedene Ausrichtungen, doch praktisch geht das Studium oft weiter wie bisher: Man hat Hauptfachunterricht bei einer Lehrkraft und mehr oder weniger unwichtige Nebenfächer. Fragen nach der beruflichen Ausrichtung, einem persönlichen Interpretationsstil oder gar nach dem Charakter der Studierenden stellen sich oft nur abstrakt; im Hauptfachunterricht geht es letztlich darum, Repertoire zu erarbeiten, zu üben und die Korrekturen der Lehrkraft umzusetzen. Dies prallt oft auf die Lebensrealitäten der Studierenden: Wer schon vier Jahre studiert und sich in der Klassik-Szene bewegt hat, ist ein anderer Mensch als ein unerfahrener „Erstie“. Man hat erste Eindrücke des Arbeitsmarkts gesammelt, Verbindungen zu anderen Musiker*innen geknüpft und nicht zuletzt Lebenserfahrungen hinzugewonnen. Man hat regelmäßige berufliche Verpflichtungen wie Schüler*innen unterrichten oder Aushilfsengagements in Orchestern. Oder man wohnt in einer anderen Stadt und pendelt nur zum Unterricht in die Hochschule. So war es auch bei Sandra*, mit der wir per Videokonferenz gesprochen haben. Dabei schilderte sie uns ihre Eindrücke aus dem Masterstudium.
* Alle Namen wurden so geändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Personen gezogen werden können. Die richtigen Namen sind den Autoren bekannt. Ähnlichkeiten zu anderen Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.
Im Masterstudium
Als Sandra ihren Master anfing, war sie auf dem Höhepunkt ihres Könnens. „In der Zeit war ich einfach gut. Ich habe sehr viel geübt, war virtuos – es lief einfach“, sagt sie. Beim berühmten Professor Meier* wollte sie sich den Feinschliff holen, den sie für die ganz großen Probespiele brauchte. Aber sie hatte auch – wie oben geschildert – Verpflichtungen, daher wohnte sie nicht in der Stadt ihrer Hochschule und kam nur zum Unterricht vorbei. Um Missverständnisse zu vermeiden, klärte sie dies mit Meier direkt zu Beginn des Studiums. Ihm sei dies recht gewesen, sagt Sandra.
Die ersten Wochen mit ihm liefen gut. Sandra war eine starke Persönlichkeit, die genau wusste, was sie konnte und wollte. Ihr Vater war Musiker in einem großen Orchester gewesen und Sandra kam bereits als Jugendliche zum Jungstudium an eine Musikhochschule. Eine Stelle im Orchester – das war von Anfang an ihr Ziel gewesen. Meier respektierte sie zunächst und bekräftigte sie in ihren Zielen. Den Glaubenssatz „Nur wenn Du eine feste Stelle hast, bist Du ein guter Musiker“, den Sandra aus ihrem Umfeld kannte, hatte auch er verinnerlicht. Daher sah sie auch über manche menschlichen und fachlichen Probleme hinweg, etwa, wenn er sich regelrecht damit brüstete, dass er seit drei Jahren keinen Klassenabend mehr veranstaltet hatte.
Das Probespiel
Erste Risse bekam das Verhältnis, als sie zum Probespiel für die Akademie eines namhaften Orchesters fuhr. Sie fühlte sich gut vorbereitet; ihr Lehrer bestätigte ihr dies. Sandra sagt, das Probespiel sei eine „gute Erfahrung“ gewesen; der Druck sei zwar sehr hoch gewesen, aber sie habe „gut abgeliefert“. Sie war zufrieden mit ihrer eigenen Performance, aber die Konkurrenz – knapp 50 Bewerber*innen – war natürlich auch gut vorbereitet. Sie bekam die Stelle nicht – für Meier eine Katastrophe! Als sie wieder in den Unterricht kam, begann das Verhältnis zum Lehrer zu kippen. „Er fragte sofort: Warum hast du die Stelle nicht gekriegt?!“, erinnert sich Sandra. Für ihn habe es nur eine Erklärung gegeben: Sie müsse einfach mehr üben. „Ich habe so viel geübt. Und ich bin dann so unglücklich darüber geworden.“
Wie kann es sein, dass ein erfahrener Musikprofessor nicht versteht, dass bei der heutigen Arbeitsmarktlage nicht jede*r Bewerber*in die Stelle sofort gewinnt? Wie kann es sein, dass ein Professor die Leistung einer Studentin an einem Tag als zufriedenstellend bewertet, nur um sie kurz darauf vernichtend zu kritisieren? Warum hielt es Meier nicht für nötig, bei einem Probespiel, dessen Ausgang ihm offenkundig extrem wichtig war, den Studierenden vorher spezielles Probespieltraining anzubieten? Warum gab er Sandra nicht wenigstens die Möglichkeit, ihr Programm bei einem Klassenkonzert zu präsentieren? Und die wichtigste Frage: Welches pädagogische Konzept verfolgte Meier? Über die Antworten auf diese Fragen kann auch Sandra natürlich nur spekulieren, doch einen Eindruck wurde sie in ihrem Studium nicht mehr los: Meier war der eigene Ruf offenbar wichtiger als die Karrieren seiner Studierenden. Bestand die Gefahr, dass jemand seinen Ruf „beschädigte“, gab es Probleme.
Der Meisterkurs
Dieser Eindruck verstärkte sich beim Meisterkurs mit dem berühmten Musiker Weber*. Der Kurs fand innerhalb der Hochschule statt, die teilnehmenden Studierenden wurden von Meier handverlesen. Auch Sandra gehörte zu den „Glücklichen“. „Weber war bekannt dafür, Menschen extrem abwertend zu behandeln“, sagt Sandra. Bei ihrer Stunde mit ihm schauten die ganze Klasse und viele Personen der Hochschule zu. Es kam, wie es kommen musste: Im Laufe der Stunde zerpflückte Weber alles an ihr und ihrer Interpretation. „Ich musste meine ganze Energie darauf verwenden, ihm während der Unterrichtsstunde nicht die Noten vor die Füße zu werfen und zu gehen“, sagt sie. Im Nachhinein, denkt sie, wäre das die einzig richtige Reaktion gewesen. Von den anwesenden Personen sagte niemand etwas – auch nicht, als Weber immer abwertender und beleidigender wurde.
In der Nachbesprechung fragte Meier sie, was sie aus dem Kurs für sich persönlich mitnehmen würde. Sandra deutete vorsichtig an, dass sie nicht alles, was Weber gesagt hatte, hilfreich gefunden hätte. Meier gab ihr zu verstehen, das dies ihre eigene Schuld sei: „Er sagte, man müsse sich auf so einen Stil eben auch einlassen. Im Nachhinein frage ich mich, ob Meier mich ausgewählt hat, damit ich diese Erfahrung mache und um meinem Selbstbewusstsein einen Dämpfer zu verpassen.“ Manchen Lehrkräften ist es anscheinend sehr wichtig, auf diese Art Hierarchien deutlich zu machen.
In der Abwärtsspirale
In der Folge verschlechterte sich Sandras Verhältnis zu Meier zusehends. Immer öfter war er unzufrieden mit ihr und ihrem Spiel. Sandra war wirklich gewillt, seinen Ansprüchen zu genügen und hart zu arbeiten. Wie er es eingefordert hatte, übte sie noch mehr als sowieso schon. Bei den Probespielen lief es mittlerweile gar nicht mehr. Sie setzte sich immer mehr unter Druck und verkrampfte irgendwann. „Ich erinnere mich an eine schlimme Schlüsselsituation. In einer besonders frustrierenden Stunde sagte er resigniert: ‚Irgendwie wirst du immer nur schlechter.‘ Ich fing an, bitterlich zu weinen. Damit konnte er überhaupt nicht umgehen, war sozial völlig überfordert. Ich hatte das Gefühl, er denkt: ‚Da kommt Wasser aus ihren Augen, wie konnte das passieren?‘“ Immerhin: Eine Ursache hatte er ausgemacht: „Meine Nervosität sei das Problem, meinte er.“
Doch damit hatte Sandra bis dahin nie Schwierigkeiten gehabt. Ihr Lehrer zuvor hatte darauf geachtet, dass man angstfrei spielte. Er wandte Methoden an, die Angst nehmen und Selbstbewusstsein schaffen sollten. Eine Lehrkraft, der auch der psychische Zustand der Studierenden wichtig ist: Damit hatte Sandra gute Erfahrungen gemacht. Meiers „Ansatz“ funktionierte bei ihr dagegen gar nicht: „Irgendwann war der Druck so schlimm und so groß. Am Ende habe ich darüber nachgedacht, aufzuhören mit der Musik. Mein Instrument war plötzlich nur noch so ein Gerät. An manchen Tagen konnte ich es kaum auspacken. Sehr viel von dem, was ich gerne machte und gut konnte, hatte die Leichtigkeit verloren.“
Doch noch ein Klassenabend
Kann man solche Lehrmethoden überhaupt als pädagogischen Ansatz bezeichnen? Meier sah das Unterrichten offensichtlich nie so, dass er für die Leistung seiner Studierenden verantwortlich war. Gab es gute Musiker*innen in seiner Klasse, schmückte er sich natürlich damit. Entsprachen sie nicht seinen Vorstellungen, war dies deren eigene Schuld. Dann war seine größte Sorge, dass Außenstehende davon erfuhren. Vielleicht war das auch der Grund, warum er die öffentlichen Klassenabende scheute. Für die Studierenden war das ein großes Problem, meint Sandra: „Es gab keine Möglichkeit, sich auszuprobieren und entspannt Feedback zu bekommen.“ Als er dann, gegen Ende von Sandras zweitem Semester, doch ein Konzert veranstaltete, machte er die Studierenden wochenlang damit verrückt, es müsse alles „perfekt“ werden: „Er gab uns klar zu verstehen, dass wir ihn auf gar keinen Fall blamieren dürften!“
Als ob dies nicht schon genug Druck gewesen wäre, hatte Sandra am Tag des Konzerts vormittags noch ein Probespiel. Den Morgen verbrachte sie bei ihren Eltern, wo sie plötzlich nervlich zusammenbrach. Ihre Mutter fuhr sie schließlich zum Probespiel, wo Sandra zum ersten Mal Betablocker nahm. Sie spielte trotzdem schlecht, sogar so schlecht, dass es ihr richtig peinlich war. Natürlich bekam sie die Stelle nicht. Abends saß sie komplett am Ende auf der Bühne. „Ich dachte: Jetzt spiele ich einfach, wie es mir gefällt, und er kann mich nicht unterbrechen. Fuck you!“ Ein befreiender Gedanke: Sie spielte mit letzter Kraft und gab alles. „Es war wohl sehr gut. Hinterher sagte er zu mir: ‚Ich hätte nicht gedacht, dass du das in dir hast.‘“
Ein klärendes Gespräch
Am Ende des Semesters suchte Sandra das Gespräch mit Meier. Sie wussten wohl beide, dass es so nicht weitergehen konnte. In Sandras Erinnerung lief das Gespräch ruhig und konstruktiv ab, doch es wurde auch klar: Meier meinte, dass Sandra ihm nicht genügend Respekt entgegenbrachte. „Er nahm mir beispielsweise übel, dass ich einmal nicht sein Konzert, das er gab, besucht hatte. Dabei hatte ich am selben Tag ein eigenes Konzert gehabt.“ Er verlangte, dass sie mehr Präsenz und mehr Verbindlichkeit zeigen sollte, zum Beispiel indem sie bei anderen Studierenden im Unterricht zuhörte. Davon war vorher nie die Rede gewesen und für Sandra war es aufgrund ihrer Wohn- und Arbeitssituation auch nicht ganz einfach. Trotzdem versuchte sie ihm entgegen zu kommen und versprach, sich verbindlicher zu zeigen.
Es gibt leider Lehrkräfte an Musikhochschulen, die pädagogisch und menschlich kaum für den Lehrberuf geeignet sind. Wer als gute*r Musiker*in gilt, bekommt auch ohne diese Qualifikationen Stellen. Die menschlichen Dramen, die daraus entstehen, nehmen die Hochschulen leider in Kauf. Doch nicht nur für die Studierenden ist dies schlimm, sondern auch für all die Lehrkräfte, die pädagogisch hervorragend arbeiten. Ihre Leistung gerät in Verruf und sie werden unter Generalverdacht gestellt. Dazu kommt, dass es eigentlich sehr klare Vorgaben der Hochschulen gibt, was eine Lehrkraft im Rahmen ihres Arbeitsvertrages leisten muss. Regelmäßige Klassenabende oder auch wöchentlicher Unterricht sind keine Zusatzleistungen oder gar Überstunden, für die man der Lehrkraft dankbar sein muss. Es sollte für eine Lehrkraft selbstverständlich sein, dass sie ihren Arbeitsvertrag erfüllt. Wer sich das Recht herausnimmt, auf einzelne Aspekte zu verzichten oder wer dafür von Studierenden mehr als den selbstverständlichen Respekt einfordert, der hat seinen Beruf nicht verstanden.
Der Augenöffner
Nach den Semesterferien ging der Unterricht ganz normal weiter. Ihrer Zusage entsprechend war Sandra nun öfter in der Stadt und besuchte auch die Stunden der anderen Studierenden. In einer Stunde kam die ganze Klasse zusammen. Ein Kommilitone spielte und wurde von Meier vollkommen auseinandergenommen. Sandra fand: Zu diesem Studenten war er noch viel unangenehmer als zu ihr! „Irgendwann sagte er: ‚Macht die Tür zu, ich will nicht dass jemand hört wie schlecht meine Klasse ist.‘“ Dieser Moment öffnete ihr die Augen. „Ich verstand auf einmal: Es liegt ja gar nicht an mir, das macht er mit den anderen genauso!“ Als sie den Unterrichtsraum verließ, schwor sie sich, niemals wieder dorthin zurück zu kommen. Sie ließ sich ab da für den Rest des Semesters krank schreiben und beendete anschließend ihr Studium. Mit Meier verkehrte sie nur noch per Email. „Er schien auch erleichtert, dass ich ging“, glaubt sie. Sie versuchte nicht mehr, die Situation zu klären, sondern schrieb nur sehr höflich, dass sie sich anders orientieren wolle. „Ich wollte ihn einfach nur nie wieder sehen müssen.“
Für Sandra ging die Geschichte glimpflich aus. Sie erkannte schließlich, woher der Druck, den sie sich machte, wirklich kam. „Meine Mentaltrainerin fragte mich: ‚Wovor hast du Angst, wenn du ein Probespiel machst?‘ Ich antwortete: ‚Dass meine Eltern und mein Lehrer enttäuscht sind, wenn ich ihnen erzählen muss, warum ich schon wieder rausgeflogen bin.‘ Als mir das klar wurde, habe ich erst mal entsetzlich geweint.“ Später löste sie sich von ihrem Berufsziel Orchestermusikerin und arbeitet seitdem als Freiberuflerin. Dieser Schritt war für sie nicht einfach, denn sowohl in ihrem Umfeld als auch in ihrem eigenen Denken gab es bis dahin keinen Raum, freie Musikschaffende zu sein. „Das war einfach kein Berufsbild!“ Für viele Musiker*innen ist es schwer, so eine Entscheidung nicht als Scheitern zu sehen. Das ist aber Unsinn: Bei nur etwa 20 % der Absolvent*innen, die eine feste Stelle bekommen, finden sich auf dem freien Markt genau so hervorragende Künstler*innen wie im Orchester.
Den Schritt bereut Sandra bis heute nicht. Die Freiheiten, die diese Arbeit mit sich bringt, genießt sie sehr: „Ich muss nicht mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich das nicht will. Ich kann immer meine persönliche und künstlerische Unabhängigkeit bewahren. Dadurch, dass ich diese Erfahrungen machen musste, ist es ein essentieller Teil meiner Arbeit, mit anderen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das versuche ich auch in meinem eigenen Unterricht umzusetzen. Das oberste Gut ist, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Meine individuelle Freiheit ist mir so wichtig, dass ich darauf niemals mehr verzichten möchte.“ Auch deshalb setzt Sandra sich heute für die Interessen freischaffender Musiker*innen ein.
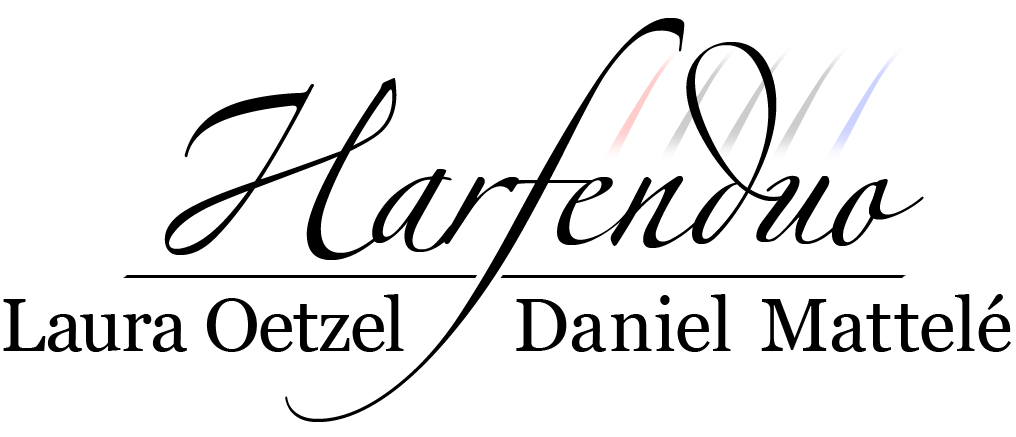


1 Comment
Ein wichtiger Artikel. Sexuelle Übergriffe sind schlimm, aber nur eine Variante der Machtausübung. Dies hier ist ein leider häufiger Fall von seelischer Gewalt im Interesse des Egos eines Lehrenden.